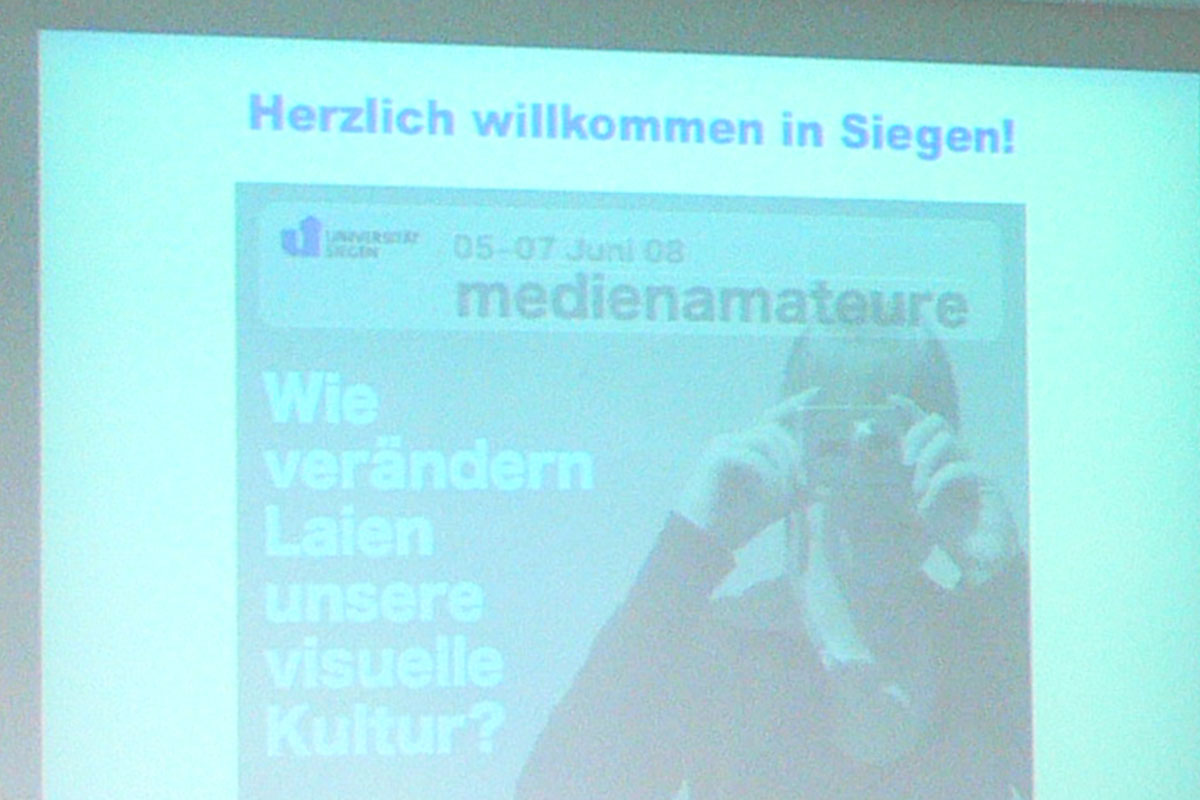Wer von Medien spricht, darf vom Internet nicht schweigen, hat es sich doch innerhalb eines Jahrzehnts zum Meta-Medium entwickelt, das andere Medien bzw. deren Funktionalität integriert – und das nicht so sehr aufgrund technischer Veränderungen (die immer noch gebräuchlichen technischen Standards sind – abgesehen von Verfeinerungen und Verbesserungen – um einiges älter), sondern aufgrund der weiter wachsenden Verbreitung und Nutzung. Zwar ist seine Nutzung nach wie vor ein Privileg der entwickelteren Länder, aber es trägt in sich die Möglichkeit zum weltumspannenden Medium. Und was noch wichtiger ist: es ist dezentral und läßt sich wahrscheinlich nur noch gewaltsam unter annähernd völlige Kontrolle bringen.
Ein Schwerpunkt in der Nutzung liegt inzwischen im Senden und Empfangen von Musikdateien – illegal in den peer-to-peer-Tauschbörsen (wobei man hier den Pauschalisierungen der Musikindustrie nicht in jedem Fall folgen mag) oder legal in den käuflichen Downloads bei entsprechenden Anbietern, wie etwa dem iTunes Musik Store der Firma Apple. Und damit ist nicht das Beatles-Label gemeint: bezeichnenderweise kommt das erste und bisher konkurrenzlos praktikable legale System zum Erwerb käuflicher Musik online von einer Computerfirma, und nicht von einer Plattenfirma oder einem Verbund mehrerer solcher Firmen.
Daraus die Gleichung abzuleiten »Musik + kostenloser Download = illegal«, wie es mancherorts geschieht, ist natürlich Unsinn. Denn zwischen den beiden genannten Optionen, Musik entweder kostenlos und illegal oder kostenpflichtig und legal über das Netz zu beziehen, hat sich eine neue Nische aufgetan, in der sich die Weblabels eingerichtet haben. Ihre Zahl ist kaum noch zu überscheuen, und es kommen ständig neue hinzu. Stellt sich also die Frage, was Weblabels eigentlich sind, was sie von den »echten« Labels unterscheidet und warum sie diesen in manchen Aspekten gehörig Konkurrenz machen können. Dazu nachfolgend ein paar Definitionsversuche.
Das Wort Label, im Kontext von Tonträgern, stammt aus dem Englischen und bezeichnete ursprünglich den Aufkleber in der Mitte der Schallplatte. Neben möglichen inhaltlichen Angaben (zu Album, Titel, Interpret, Dauer etc.) fand sich auf dem Label mindestens der Name oder Schriftzug der Firma, die die Platte veröffentlicht hat. Das war nötig, denn gerne gerät in Vergessenheit, daß die Plattencover ursprünglich ungestaltete Papierhüllen waren und erst mit dem Ende der Schellackplatte und dem Siegeszug der Vinylschallplatten (die dünner und flexibler waren und somit auch einen stärkeren Karton als Schutzhülle benötigten), der vor etwa 50 Jahren begann, mehr Informationen boten – was wiederum das Label als bis dato alleinigen Informationsträger entlastete.
Schließlich wurde Label zum Sammelbegriff, der nicht mehr nur den Aufkleber, sondern die ganze Firma bezeichnete. Zur Begriffsklärung sei vorerst festzuhalten, daß Label eine Firma bezeichnet, die Musik auf Tonträgern veröffentlicht.
Ein Label ist jedoch noch viel mehr als bloßer Produktionsdienstleister: es ist immer auch ein Filter für Stilrichtungen, und nur wenige Labels präsentieren tatsächlich schlüssig stil- und genreübergreifende Musik – meistens spezialisieren sie sich auf einen Stilschwerpunkt, wie etwa Rock, Jazz, Klassik, ethnische Musik etc. Ein Label bringt außerdem selten einzelne Tracks heraus, sondern vereint mehrere Tracks zu Veröffentlichungen (sofern dies nicht der Künstler oder die Band macht – ein Beispiel wären thematische Compilations wie Querschnitte durch das Labelprogramm, Sammlungen unterschiedlicher Künstler zu einem gleichen Thema etc.). Darüber hinaus sind die Labelmacher in den meisten Fällen daran interessiert, einen Stil oder einen Künstler besonders zu pflegen, arbeiten also meistens konzeptionell vorausschauend und planerisch.
Viele Labels sind unter den Dächern der »Großen Vier« (EMI, Sony BMG, Universal und die Warner Music Group – die sogenannten Majors) versammelt, die unter sich etwa 75 Prozent des gesamten Tonträgermarktes aufteilen. Die restlichen 25 Prozent decken sogenannte Independent-Labels ab, die wiederum teilweise von Independent-Vertrieben gebündelt und vermarktet werden.
Ein Web- oder Onlinelabel stellt seine Tonträger nicht mehr physikalisch her durch gefertigte Auflagen in einem Press- oder Kopierwerk, sondern bietet einen virtuellen Tonträger an, der aus einem oder mehreren Musikstücken besteht, möglicherweise ergänzt um eine Bild- oder PDF-Datei, die das Artwork enthält, mit dem der Empfänger der Dateien z. B. ein Booklet, ein Cover, ein Label (als Aufkleber) oder anderes selbst herstellen kann. Das besondere dabei ist, daß es sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Onlinelabels gibt, bei denen sich die Künstler entweder selbst vermarkten, oder – wie in der Welt der physikalischen Tonträger – unterschiedliche Künstler thematisch zusammengefasst werden.
Ein Beispiel für ein kostenpflichtiges Label wäre etwa die Website der australischen Severed Heads, die in den 1980er und 1990er Jahren auf diversen Independent-Labels veröffentlicht haben und mittlerweile den gesamten Backkatalog als kostenpflichtigen Download anbieten – in MP3, mit Artwork und zu moderaten Preisen (verglichen mit den Preisen, die die Alben in Second Hand-Märkten erreichen). Aber auch Künstler, die nicht unbedingt verdächtig sind, auf kleine Independent- Strukturen angewiesen zu sein, vermarkten sich mittlerweile direkt über das Internet (z. B. Prince).
Auf der anderen Seite steht eine ständig wachsende und schon längst nicht mehr überschaubare Zahl von Weblabels, die ihren gesamten Katalog kostenlos anbieten. Und es gibt natürlich Mischformen: Label, die teilweise kostenlose Downloads, teilweise kostenpflichtige Tonträger (oft im CD-R-Format) anbieten, oder nur kostenpflichtige Alben anbieten, wobei ein oder zwei Stücke als Appetithäppchen kostenlos als Download angeboten werden (wenn auch oft in verminderter Audioqualität). Und: auch Labels, die ehedem physikalische Tonträger veröffentlicht haben, inzwischen aber nicht mehr existieren, stellen ihren Backkatalog überwiegend oder ganz frei im Web zur Verfügung, z. B. Irdial Discs oder ZNS-Tapes. Andere Webseiten fungieren als Archive für längst vergriffene Tonträger und Medien und präsentieren diese ebenfalls zum freien Download online – Ubu Web kümmert sich so um vergessene oder vergriffene Medien der Avantgarden des 20. Jahrhunderts und fungiert gleichermaßen als »Label für Wiederveröffentlichungen« in diesem Bereich.
Zu den echten Weblabels zählen, im Selbstverständnis wie in der Wahrnehmung von außen, nur solche, die ihr Programm komplett kostenlos anbieten. Das scheint auf den ersten Blick widersinnig zu sein, weshalb der Begriff »kostenlos« hier kurz analysiert werden soll: Kosten im Internet fallen an unterschiedlichen Stellen an. Zuallererst beim Zugang – es gibt keinen kostenlosen Zugang, höchstens die Möglichkeit, einen Zugang kostenlos zu nutzen (z. B. an der (Hoch-)Schule, in der Firma, im Elternhaus etc.); es fallen immer Kosten an, sowohl für das Equipment, das den Onlinezugang technisch ermöglicht (Hardware, Modem etc.), als auch für die Bereitstellung einer Leitung und die Übermittlung der Daten (durch einen Internetprovider, dauerhaft per Vertrag oder sporadisch per Call-by-Call). Weiterhin entstehen Kosten bei der Bereitstellung von Inhalten: auf Anbieterseite benötigt man einen geeigneten Webspace, der ebenfalls kostenpflichtig ist, mit unterschiedlichen Optionen bezüglich der Größe des Speicherplatzes und der Höhe des Traffic, d.h. der Menge an abgerufenen Daten durch beliebige Surfer von diesem Speicherplatz (Ausnahmen: freie Speicherplätze wie bei scene.org oder archive.org, die fremdfinanziert sind durch Sponsoren wie Fördervereine, Universitäten etc.).
Neben der Kostenfrage stellt sich natürlich auch die Frage nach einem möglichen Gewinn. Den machen, wie bisher beschrieben, lediglich Instanzen, die zwischengeschaltet sind zwischen Weblabel und Surfer. Und natürlich der Surfer, der, selbst wenn ihm Kosten beim Surfen entstehen, doch wesentlich billiger an komplette Alben von Künstlern kommt, als wenn er diese in einem Laden erwerben würde. Die Labels und Musiker gehen scheinbar leer aus, bzw. zahlen sogar drauf – was die berechtigte Frage aufwirft, ob hier eine Horde von Gutmenschen die Früchte ihrer Arbeit selbstlos verschenkt und wortwörtlich »nicht ganz bei Groschen ist«.
Plausibler wird das Ganze, wenn man sich der Kosten-Nutzen-Rechnung von einer anderen Seite aus nähert und sich die Strukturen anschaut, speziell die von Produktion und Vertrieb. Dazu ist ein kleiner geschichtlicher Exkurs nötig, dessen Anfangspunkt hier auf die Mitte der 1970er Jahre gesetzt wird – zurück zu den Anfängen dessen, was heute gemeinhin als Independent-Szene angesehen wird. Damals bildete sich, im Zuge von Punk und anderen neuen Wellen, eine unabhängige Label- und Vertriebsstruktur heraus, die ihren Zenit Ende der 1980er Jahre erreichen und ein weiteres Jahrzehnt später in weiten Teilen komplett einbrechen sollte (exemplarisch seien hier nur die Pleiten des Rough Trade-Vertriebs oder des EFA-Vertriebs genannt, die sich beide schon fast zu Majorfirmen gewandelt hatten, und deren Abgang auch etliche der vertretenen kleinen Label mitgerissen hat).
Junge Künstler kamen bei großen Firmen kaum noch unter – teilweise, weil ihr Material zu wild, zu experimentell oder zu politisch war, aber auch, weil die bestehenden Plattenfirmen übersättigt waren mit Künstlern, die Alben in Millionenauflagen absetzten, und dazu übergegangen waren, sich den Nachwuchs lieber selbst zu schaffen (zuerst Retortenbands, denen man die lippensynchrone Pseudoechtheit zumindest bis zum Milli Vanilli-Eklat abnahm, inzwischen ist man aber dazu übergegangen, diese künstlichen Identitäten vor aller Augen via Castingshow im TV zu schaffen), anstatt weiter im großen Stil nach jungen, unverbrauchten Bands zu suchen.
Viel entscheidender war aber, daß die technischen Voraussetzungen andere waren als zuvor. Mit der analogen Compact Cassette hatte sich ein leicht zu bespielendes und zu vervielfältigendes Medium im Konsumentenbereich etabliert, das sich auch auf Produzentenseite nutzen ließ. Der Preisverfall bei den großen Tonbandgeräten, speziell den 4- oder 8-Spurmaschinen, die Einführung kompakter Mehrspurgeräte (Tascam, Fostex etc.), die mit handelsüblichen Kassetten funktionierten, und der Zuwachs an immer billiger werdendem Equipment wie Synthesizer, Sequencer, Drumcomputer, Sampler etc. machten in der Folgezeit die Herstellung und Vervielfältigung von Musik für die breite Masse erschwinglich, fast jede Band im Independent-Sektor hat mit Kassettenveröffentlichungen debütiert.
Aber auch die Kosten für echte Pressungen sanken, die Vinylschallplatte war technisch perfektioniert, und Veränderungen hier machten sich nur noch durch sinkende Preise bemerkbar: während die Majorfirmen seit Beginn der 1980er Jahre auf die digitale Produktion und die Compact Disc als Wiedergabemedium setzten, boomten im Independentbereich analoges (elektronisches) Equipment sowie das analoge Medium Vinyl. Die Plattenhüllen wurden dabei oft auch in Handarbeit hergestellt – teilweise aus Kostengründen, meistens aber als haptisches und optisches Extra bzw. Unterscheidungsmerkmal zur Einheitsware, gegen die man sich abzugrenzen suchte. Bei den Kleinauflagen von meist weniger als tausend Exemplaren eine mühselige, aber doch zu bewältigende Fleiß- und Bastelarbeit (die übrigens heute wiederkehrt im Selberbrennen, -drucken und -basteln von heruntergeladenen Onlineveröffentlichungen, allerdings auf Konsumenten- statt auf Produzentenseite).
Durch den weitgehenden Rückzug der Majors aus der Vinylproduktion (das Medium wurde schon vor 20 Jahren für tot erklärt) stiegen die Preise in diesem Bereich wieder an aufgrund des Wegfalls etlicher Produktionsstätten sowie der Verteuerung der Produktion mangels Nachfrage. Es ist der DJ-Kultur zu verdanken, daß sie nicht zuletzt das Vinyl über die Jahre gerettet hat als unerläßliches Tool für das DJ-Set, auch wenn jüngere Entwicklungen (reine Laptop-DJs bzw. Vinylsimulationen wie Final Scratch) in eine andere Richtung weisen und auch CD-Player sich mittlerweile im Handling dem Plattenspieler annähern – bis hin zum Aufsetzen einer Pseudoplatte auf das Gehäuse, die sich wie eine Schallplatte dreht und direkt manipulierbar ist (Stoppen, Beschleunigen, Scratchen etc.).
Parallel zum genannten Kostenanstieg in der Herstellung (und im Vertrieb) von unabhängiger Musik tritt nun das Phänomen Internet auf, das in seiner heutigen Form 1990 begründet wurde durch Tim Berners-Lee am Schweizer CERN, speziell durch seinen Entschluss, die von ihm entwickelten Protokolle zur Vernetzung von Computern und zum Datentausch – HTML und HTTP – als offene Standards weiterzugeben, statt zum Patent anzumelden. Und natürlich muß das Fraunhofer Institut erwähnt werden, in dem das Audiokompressionsverfahren MP3 entwickelt wurde als Versuch, speicherintensive Audiodateien (wie auf der CD vorhanden) ohne hörbare Qualitätseinbußen zu verkleinern. Ähnliche Versuche gab es auch abseits des PCs: Die Digitale Compact Cassette von Philips (DCC) konnte sich nicht am Markt behaupten), die MiniDisc von Sony (MD – heute noch gebräuchlich, z.T. auch bei Profimusikern als Alternative zum »Digital Audio Tape« DAT) hat sich als preiswertes und durchaus kreativ nutzbares Substitut der Compact Cassette behauptet und bietet einen weit besseren Klang als MP3 durch die geringere Komprimierung (20% gegenüber der CD; MP3 komprimiert i.d.R. auf 10% oder weniger des ursprünglichen Signals). Aber erst die Kombination von plattform- und browserunabhängigen Internetstandards, von MP3 als vergleichsweise hochwertigem Audioformat und der immer weiter wachsenden Zahl von Internetbenutzern hat die Grundlage für das Weblabel-Phänomen geschaffen.
Es ist nun möglich, mit einem Minimum an Kosten ein Maximum an Effizienz (Vertrieb, Promotion etc.) zu erzielen. Es fallen die Produktionskosten beispielsweise einer Vinylschallplatte oder einer CD weg – und die sind üblicherweise der kleinere Betrag, den man aufwenden muß, um Musik publik zu machen: Anzeigenschaltungen in und Bemusterungen von Medien, die Suche nach geeigneten Vertriebsmöglichkeiten (nicht nur national) und andere Kosten multiplizieren sehr schnell die bloßen Herstellungskosten. Dabei bewegt man sich in einem hoffnungslos übersättigten Markt, in dem sich immer mehr Veröffentlichungen auf immer weniger Konsumenten verteilen. Denn Hand in Hand mit der Verbreitung von Musikdaten via Internet geht die neueste Entwicklung bei den Abspielgeräten – weg vom Format (Kassette, MiniDisc oder CD können längst schon auf tragbaren, handlichen Geräten abgespielt werden), hin zur Datei, die auf ein beliebiges Gerät übertragen und dort wiedergegeben wird: MP3-Player mit Festplatte (z. B. iPod) oder Flash-Speicher (USB-Stick), als eigenes Gerät oder integriert in andere Geräte, z. B. dem Mobiltelefon, aber auch CD-Player, die nicht mehr nur Audio-CDs, sondern auch MP3-CDs abspielen können und so die Fassungsvermögen der CD an Musik von 80 Minuten auf das zehnfache erhöhen. Dabei gibt es MP3-Player hierzulande bereits ab ein paar Euro, und die Preise sinken weiter.
Das wirkt sich natürlich auf das Konsumverhalten aus – keine Entdeckungsreisen mehr durch die Plattenläden, stattdessen mal eben nebenher im Netz gestöbert und mehrere Stunden Musik in wenigen Minuten auf die Festplatte geladen: zum Direkthören, Brennen oder eben zum Transfer auf einen externen Player. Das bisherige Mainstreampublikum, ohne große Lust am Neuen oder am Experiment, bedient sich mit allenfalls roten Ohren bei den illegalen Tauschbörsen, um kostengünstig bis kostenlos an vermeintlich hochwertige Musik zu kommen – das macht, nicht nur zum Bedauern der Musikindustrie, die übrigens sämtliche diesbezüglichen technischen Entwicklungen der letzten Jahre schlichtweg verschlafen oder falsch eingeschätzt hat, immer noch den Löwenanteil der Downloads aus.Die abenteuerlustigeren, neugierigeren und aufgeschlosseneren Surfer suchen allerdings nach legalen Angeboten, von denen es weit mehr gibt. Einmal fündig geworden, leiten die Links, die quasi jedes Weblabel bietet, zu anderen Labels und deren Angebot.
Unterschiedliche Weblabels haben teilweise die gleichen Künstler mit jeweils eigenen Veröffentlichungen in ihrem Angebot, Portale wie das deutschsprachige phlow.net, aber auch andere versuchen, Weblabels fast schon enzyklopädisch zu listen und ergänzen die Weblabels-Szene durch Artikel, Kommentare, Interviews etc. Eine echte Flatrate vorausgesetzt, kann der Surfer zig Gigabyte Audiomaterial auf die eigene Festplatte holen und eine Sammlung aufbauen, die auf Monate hin ununterbrochen und ohne Wiederholung Musik wiedergeben kann.Die Künstler profitieren doppelt: zum einen steigt der Bekanntheitsgrad – und das wirkt sich dann auch auf ein Ansteigen der Gelegenheiten aus, bei denen tatsächlich Geld zu verdienen wäre, etwa durch Live-Auftritte oder »echte« physikalische Veröffentlichungen (deren Promo-Aufwand sich dann in Grenzen hält, da er zu einem großen Teil bereits online erledigt wurde – das beginnt schon beim nicht mehr stattfindenden Versenden von Demo-CDs oder -Kassetten). Zum anderen – und das wird heute oft übersehen – gibt es nur noch eine geringe Chance, mit einer Kleinauflage an selbstproduzierten Tonträgern überhaupt die Kosten für die Produktion hereinzuholen. In den meisten Fällen landen von einer 500er CD-Auflage, die Musiker bei ihren Live-Auftritten verkaufen oder bei einigen Läden oder anderen Anbietern unterbringen können, mehr als die Hälfte der Scheiben über kurz oder lang im heimischen Keller – oder werden vom Vertrieb verschleudert. Ein Nullsummenspiel, das wohl nur noch deshalb gespielt wird, weil es dem Ego schmeichelt, das eigene Werk auf einer »echten« CD zu sehen und sich somit nahtlos einzureihen in die Riege der großen Komponisten oder Instrumentalisten.
Aber auch Labels bietet sich eine so noch nie dagewesene Gelegenheit, Audiomaterial zu veröffentlichen, das so weit abseits vom Mainstream ist, daß es weltweit nur einige wenige Interessierte begeistern kann. Problematisch wäre hier wiederum nicht, daß eine Kleinauflage von 500 Exemplaren zu hoch ist – die Frage ist eher, wie man die Tonträger zu den Zielpersonen bringt. Indem man Produktion und Vertrieb über das Internet abwickelt, gibt es keine Streuverluste, und die Zielgruppe kann sich das Produkt herunterladen und selbst fertigen – sofern ein Internetzugang vorhanden ist.
Ein weiterer Aspekt, der so vorher nicht möglich war, ist die Kollaboration verschiedener Labels und Künstler miteinander. Gemeinsame Projekte lassen sich relativ einfach realisieren, Dateien tauschen, bearbeiten, weitergeben und schließlich zu Veröffentlichungen zusammenfassen. Hier tritt ganz stark der »Community«-Aspekt hervor – Macher von und Künstler auf Weblabels verstehen sich als Teil eines Netzwerks abseits der rein kommerziell orientierten Musikindustrie, und damit oft auch als musikalische oder stilistische Avantgarde in ihrem Bereich.
Die Differenz zur Industrie und den herkömmlichen Verfahrensweisen wird auch deutlich in den Versuchen, den bestehenden nationalen Urheberrechten (die vorwiegend die Interessen von Verwertungsgesellschaften und Unterhaltungskonzernen bedienen) eine Alternative entgegenzusetzen, die den Urhebern die Kontrolle über ihre Werke und den Nutzern die Freiheit im Umgang mit diesen zu gewährleisten – beides in größtmöglichem Umfang. Während sich in der Open Source-Entwicklergemeinde längst die GNU General Public License (GPL) durchgesetzt hat und als respektierter Standard gilt, kämpfen Künstler nach wie vor um ein Urheberrecht, das eben nicht auf kapitalistische Verwertungslogik, sondern auf Kreativität zugeschnitten ist.
Als Pionier zu diesem Thema gilt der US-amerikanische Anwalt Lawrence Lessig, der drei lesenswerte Bücher hierzu publiziert hat: »Code and Other Laws of Cyberspace« (Basic Books, 2000), »The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World« (Random House, 2001) und »Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity« (Penguin Press, 2004) – letzteres ist übrigens neben der käuflichen Druckversion auch als freier Download erhältlich. In »The Future Of Ideas« führt er nicht nur sehr plastisch vor, was unter »frei« zu verstehen ist (»frei« im Sinne von »Freier Rede«, nicht von »Freibier« …), sondern auch, wie die Urhebergesetze in Amerika mit jeder Neuerung den Anforderungen der großen Konzerne, z. B. Disney, angepaßt werden: während sich Disney Fremdkreationen, die meistens inzwischen Gemeingut geworden sind (Sagen oder Märchen wie z. B. Hercules oder Aschenputtel) in die eigene Unterhaltungs- und Verwertungsmaschinerie einverleibt, sträubt sich der Konzern beharrlich (und durch mehrere Gesetzesänderungen bisher erfolgreich), seine eigenen Geschöpfe in die »Public Domain« zu entlassen. Lessig schlägt als Gegenentwurf die »Creative Commons«-Lizenz vor, die dem Nutzer weitreichende Rechte einräumt bis hin zur Verfremdung des ursprünglichen Materials – allerdings muß die Lizenzart dieses ursprünglichen Materials auch auf die Derivate angewandt werden.
Ähnliche Lizenzmodelle finden sich auch andernorts (z. B. »Copyleft«), gemein ist ihnen allen, daß sie ausdrücklich die Weiterverbreitung und manchmal auch Weiterbearbeitung des ursprünglichen Materials befürworten – nicht zuletzt, um die Kultur als ganzes weiterzubringen. Insofern haben sehr viele Weblabels nicht nur Hinweise auf die verwendeten Lizenzmodelle parat, sondern verwenden solche, die den Autausch, die Weiterbearbeitung und die Zusammenarbeit befördern. Man geht nicht nur musikalisch nach vorne, sondern wirkt indirekt auch auf gesellschaftspolitische Aspekte ein.Zu den akustischen Resultaten der Masse der Onlinelabels muß man allerdings nüchtern folgendes feststellen: In dem Maße, in dem der Computer mittlerweile alle möglichen Geräte und Funktionen in sich vereint – als Ersatz für die Schreibmaschine, die Zeitung, das Buch, das Radio, das TV-Gerät, den Videorekorder, die HiFi-Anlage bis hin zum kompletten High-End-Tonstudio oder Schnittplatz für Kinofilmproduktionen –, in dem Maße nivelliert er die musikalischen Ausdrucksformen, was sich in einer wahren Flut an Weblabels bemerkbar macht, die elektronische Musik zwischen Ambient, Techno, House, Clicks’n’Cuts oder Dub produzieren.
Zu viele Veröffentlichungen verraten viel über die Software resp. die Plug-Ins, die der jeweilige Produzent verwendet hat, bringen das Genre, das sie repräsentieren, aber nicht wirklich weiter. Im Gegenteil – der anfänglichen Euphorie des Surfers über ein neu entdecktes Label mit 30 Veröffentlichungen folgt schnell die Einsicht, daß es sich um ein und dieselbe musikalische Grundidee handelt – wenn auch in 30 Variationen oder Interpretationen. Es scheint, als ob bei vielen Weblabels stillschweigendes Einvernehmen darüber herrscht, daß anspruchsvollere instrumentelle Musik, z. B. Jazz, nicht in das Programm paßt, und daß die veröffentlichten Tracks allesamt von Laptop-DJs gespielt und gemischt werden – um dann wieder als Mixe online veröffentlicht zu werden. Der Gedanke, daß mancher Track im Rechner entsteht, bearbeitet, verteilt und abgespielt wird, ohne jemals nach außen zu kommen – nicht einmal mehr auf einen MP3- Player – mutet irgendwie seltsam an. Dazu kommt die Tatsache, daß Kommunikation über solche Musik ebenfalls vorwiegend über den Rechner stattfindet, per E-Mail, Forum oder Chat – das 2005 neu erschienene Sceen-Magazin ist ein sympathischer, letztlich aber sinnloser Versuch, dieser Form der Kommunikation ein quasi klassisches Printmedium zur Seite zu stellen.
So scheint der Computer nicht nur alle möglichen Technologien in sich aufzusaugen, sondern auch die Menschen an sich zu binden – natürlich ist es cool, Teil eines internationalen Netzes Gleichgesinnter zu sein, aber wenn der nächste ideale Gesprächspartner hunderte von Kilometern entfernt sitzt, dann liefern diese Weblabels doch nur den Soundtrack zur Vereinzelung. Eingedenk der Tatsache, daß sich bis hin zu Lebensmitteln alle Waren inzwischen online beziehen lassen, wird der Gang vor die Tür obsolet – und so klingt mancher Track auch, als ob der Produzent seit Jahren den Rechner nicht mehr heruntergefahren geschweige denn das Haus verlassen hat. Daß vieles musikalische Material zu gleichförmig daher kommt und kaum noch jemand zuschauen mag, wenn ein Laptop »live« gespielt wird, kann nicht zuletzt am derzeitigen Revival der in echter Handarbeit gespielten Instrumentenmusik (mit Gesang) abgelesen werden. Die Weblabels werden noch überwiegend von Menschen betrieben und bestückt, die im Umgang mit dem Computer versiert sind – für die Zukunft aber ist es unerläßlich, daß auch die Musiker verstärkt diese Technologie nutzen, um ihre Inhalte zugänglich zu machen. Es mangelt derzeit nicht an Musik im Netz – aber an Musik von Musikern.
4 x 3 – Surftips des Autors
Drei beispielhafte Weblabels
www.quietamerican.org
Aaron Ximm hat eine wunderbare Webseite, auf der er zeigt, wie es gehen kann: Seine Geräuschaufnahmen (field recordings) stellt er zu thematischen Veröffentlichungen zusammen und bietet diese sowie das Ausgangsmaterial zum freien Download an. Hervorragende Künstlerseite.
www.comfortstand.com
Gerade mal zwei Jahre alt, hat das Label bereits einen exquisiten Ruf erworben für seine konsequente Veröffentlichungspolitik. Seit dem Startschuß im November 2003 mit der Doppel-CD »Two Zombies Later« (eine Sammelsurium obskurer homemade LoFi-Exotika, unter anderem mit einem Stück von Der Plan als vermutlich prominentestem Beiträger) sind weit über 80 Veröffentlichungen online zum freien Download bereitgestellt worden – alle mit Cover-Artwork, Linernotes und teilweise in Albumlänge. Neben massenhaft neuen Namen tauchen auch alte Bekannte aus der ehemaligen Kassettenszene auf, wie etwa Big City Orchestra oder R. Stevie Moore.
www.kikapu.com
Etwas geradliniger als die beiden vorgenannten, speziell die Verwendung des Begriffs IDM (für »Intelligent Dance Music«) wirkt mittlerweile eher abschreckend. Dennoch gibt es hier, vor allem bei den früheren Veröffentlichungen, die eine oder andere Perle elektronischer Musik zu entdecken – von Nick Cramer etwa, oder Glomag (dahinter verbirgt sich Chris Burke, der bereits auf dem »echten« Label Mode veröffentlicht hat – neben Luciano Berio, Anthony Braxton, John Cage oder Iannis Xenakis).
Drei tote Weblabels – ab ins Archiv und runterladen (Archivlinks auf den Seiten)
www.fukkgod.org (Fukkgod Let’s Create – abstrakt und experimentell – eines der frühen Onlinelabels)
www.irdial.com (Irdial Discs – early UK Techno & Ambient: Aqua Regia, Beautyon, Anthony Manning – alles ehemals auf Vinyl und CD veröffentlicht, also eigentlich erst post mortem zum Weblabel geworden)
www.zns.gewalt-am-objekt.org (Backkatalog von ZNS-Tapes 1987–93, Industrial & Geräusche – alles ehemals auf Kassette veröffentlicht)
Drei Archive – danach sind die Festplatten voll
www.archive.org (Nomen est omen – Tonnen von Weblabels, Filmarchiven etc.; Inhalte meist public domain)
www.sonus.ca (riesiges Archiv mit freier elektroakustischer Musik in Tradition der französischen INA/GRM)
www.ubu.com (riesiges Archiv für die Avantgarde des 20. Jahrhunderts: Musik, Filme, Magazine etc.)
Drei Startpunkte zum Weitersurfen
www.phlow.net (»Magazin für Musik und Netzkultur« – streckenweise interessantes Portal, viele Texte zum Thema und eine recht große Linkssammlung)
www.igloomag.com (ebenfalls ein Magazin, etwas älter als obiges, mit guten Texten in Englisch)
www.earlabs.org (Interessantes Label für experimentellere Veröffentlichungen auch »alter Hasen« wie Ios Smolders, dazu eine ansehnliche Linkssammlung)
Literatur (Auswahl)
Janko Röttgers: Mix, Burn & R.I.P – Das Ende der Musikindustrie
Heise/Telepolis 2003, 183 Seiten, ISBN 3936931089
und
Tim Renner: Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm!
Campus Verlag 2004, 220 Seiten, ISBN 3593376369
Beide Bücher geben einen guten Überblick über die Möglichkeiten der Audio-Distribution via Internet. Vor allem Renners Buch – er war bis 2004 Chef von Universal Deutschland – eröffnet ein Panoptikum der Dummheit, was die Einschätzung der Palttenfirmen bezüglich Musik im Netz angeht; aber auch andere Details vermitteln ein eher trostloses Bild der Majorfirmen und der Funktionsweise der Medien.
Robin James (Hg.): Cassette Mythos – Audio Alchemy
Autonomedia 1990, 206 S., ISBN 0936756691
Immer noch lesenswert: Ein Querschnitt durch die Homerecording- und DIY-Szene – technisch gesehen muss man nur ein paar Geräte austauschen, inhaltlich immer noch ein echtes Manifest für eine demokratische, paritätische Musikkultur.
Ursprünglich erschienen in
R. Behrens / M. Büsser / J. Ullmaier (Hg.):
testcard #15 – The Medium is the Mess
Ventil Verlag, Mainz 2006, 304 Seiten, ISBN 978-3-931555-14-6
Anzeigen …
»Das Internet vergisst nichts« … archive.org hat eine riesige Sammlung mit Netlabels (wo sich auch mein eigenes befindet – expiremental.com). Dort finden sich auch die verloren geglaubten earlabs-Veröffentlichungen wieder … (25. März 2020)