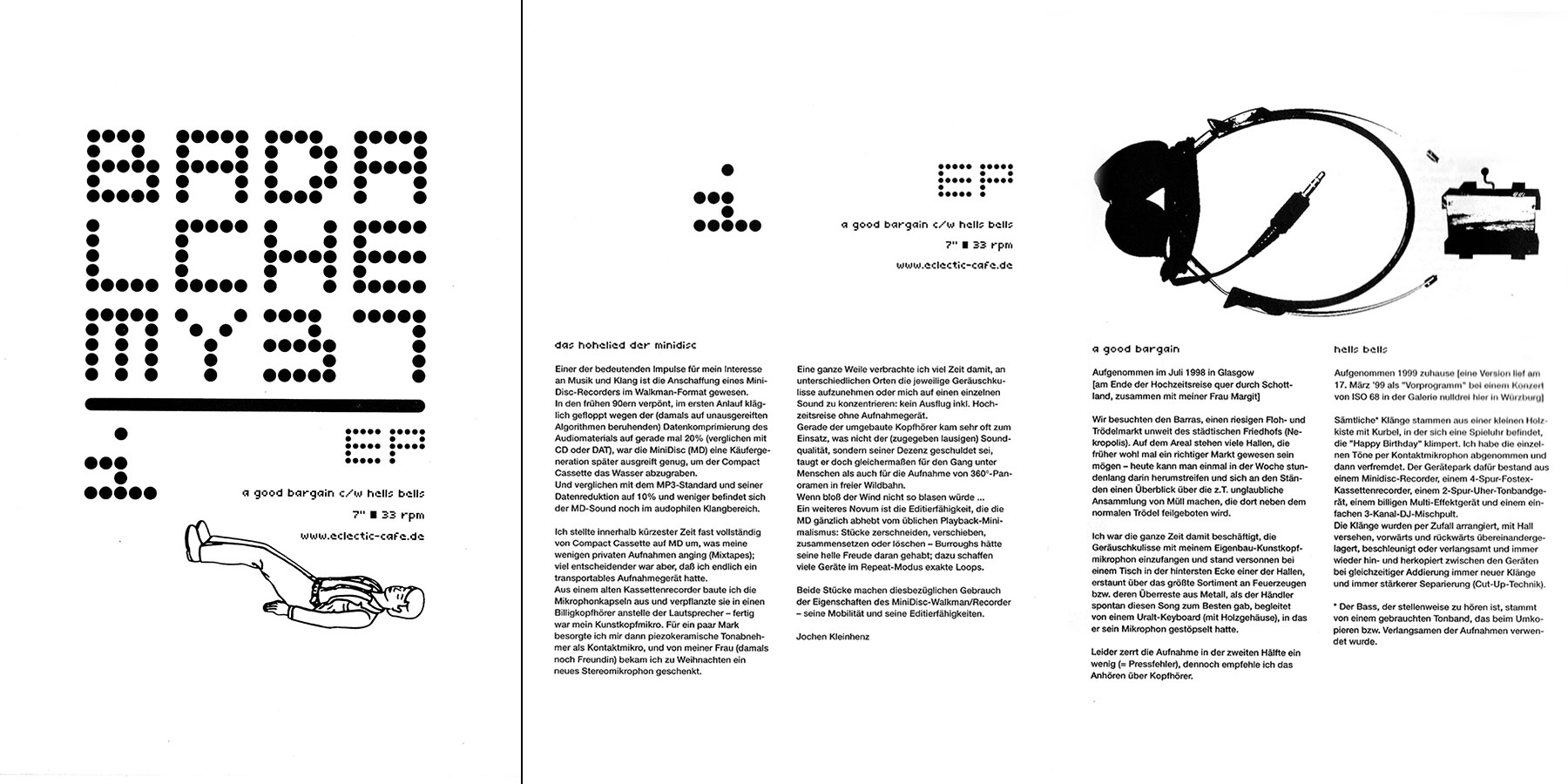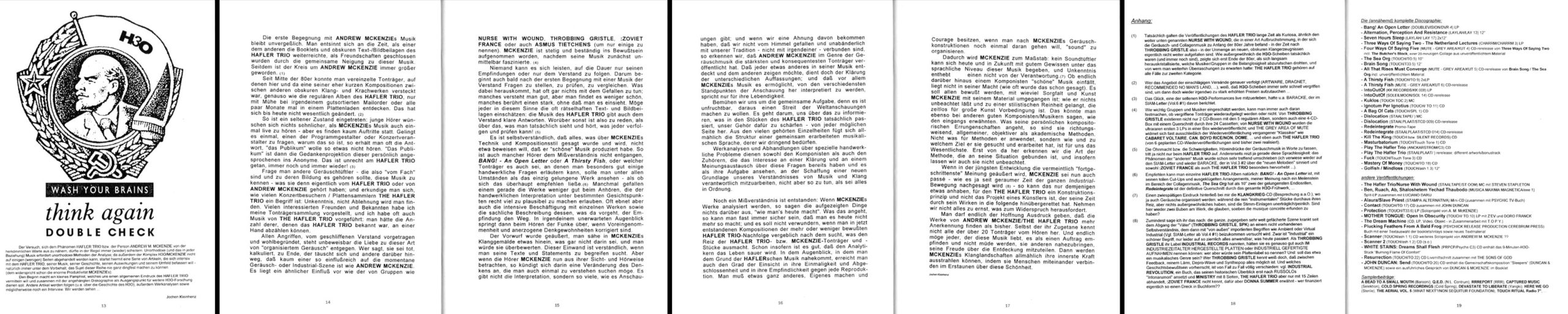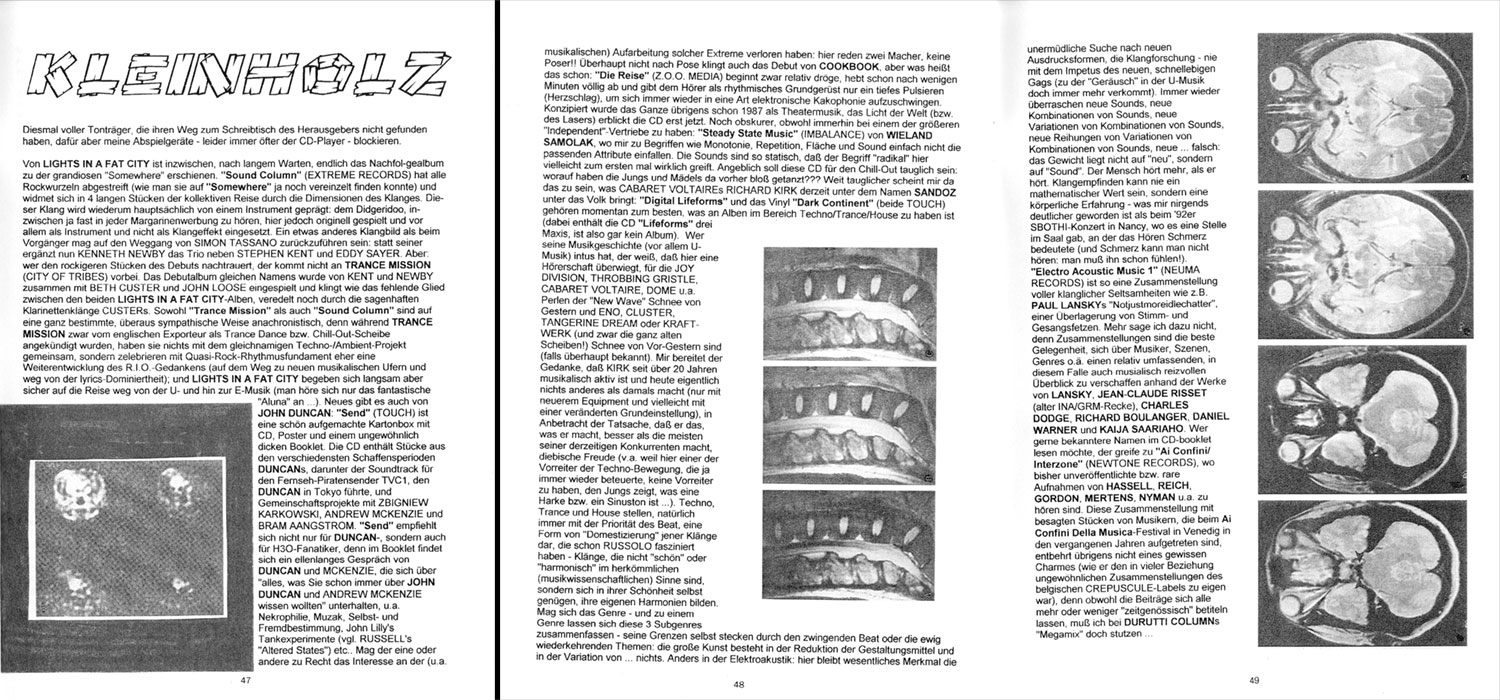»Ein Protestlied oder auch Protestsong ist ein Lied, das sich gegen eine Autorität richtet und meist soziale oder politische Missstände thematisiert. […] Es entsteht vor dem Hintergrund zu agitieren, mobilisieren, solidarisieren und sich reflektierend mit sozialen und politischen Konflikten auseinanderzusetzen. Dementsprechend zeichnet sich das Protestlied in erster Linie durch seinen Text aus. Doch auch musikalische Elemente wie Blue-Notes oder Offbeat-Rhythmen können als Gegensatz zu festgelegten Normen die kritischen Botschaften unterstreichen.«*
https://de.wikipedia.org/wiki/Protestlied
Nachdem sich der Protestsong in der Populärkultur breitgemacht hat, hat er sich viele Moden zueigen gemacht – von der Blume im Haar über Dreadlocks oder Iro zur Glatze, von der akustischen Gitarre über die elektrische hin zu Sampler und PC, vom Anti-Kriegs-Pathos einer Joan Baez über das unmittelbar folgende Anti-Hippie-Ethos der ersten Punk-Welle zum Straight-Edge-Hardcore eines Ian MacKaye oder dem frühen Elektropunk von Atari Teenage Riot. Von Wölfen im Schafspelz, wie sie Randy Newman oder Paul Weller (zur Jam/Style Council-Phase) verkörperten, ganz zu schweigen. Zusätzlich herrscht in manchen Szenen die weitverbreitete Überzeugung vor, mittels musikalischer Devianz ebenfalls mindestens Unangepasstheit, meist gar gesellschaftliche Kritik zu äußern – auch wenn diese »Sprache« auf Ausdruck, Arrangement oder Verweigerung gängiger Instrumentaltechniken beschränkt bleibt. 2020 haben mich allerdings einige Platten beeindruckt, die wieder den Text in den Vordergrund stellen und sich an der Songstruktur abarbeiten, dabei musikalisch unterschiedliche, nicht zwingend experimentelle oder innovative Wege beschreiten. Dass sie alle aus England stammen, muss nicht verwundern – das Land ist seit Thatchers Antritt vor vier Jahrzehnten in einer klareren Abwärtsspirale, was die gesellschaftlichen Zustände angeht, als andere europäische Länder, das Brexit-Desaster hat dem ganzen nur die Krone aufgesetzt. Über aktuelle Protestbewegungen in Deutschland dagegen, wie die »Querdenker« und die begleitenden »Anti-Corona-Proteste« samt der Sophie-Scholl-Vereinnahmung durch eine offensichtlich strohdumme Kasseler Psychologiestudentin, mag ich keine weiteren Worte verlieren …
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-16239161-1605802218-3974.jpeg.jpg)
Anfang Dezember habe ich mir eine (beinahe) ganze Dylan-LP gegönnt: »The New And Improved Bob Dylan« heißt die Scheibe der William Loveday Intention, die zehn Stücke des Meisters »verbessert« und zwei weitere hinzufügt, die, wie die Coverversionen, »cut in the manner of Robert Zimmermann« sind. Wenn ich nun anmerke, dass diese Veröffentlichung die erste Neuerscheinung seit etwa 20 Jahren auf dem englischen Hangman Records Label ist (HANG55-UP), dürfte der Groschen fallen: Niemand geringeres als Billy Childish steckt dahinter! Womit auch klar sein dürfte, dass die Authentizität der aktuellen Aufnahmen die Originale aus den 1960er/70er Jahren selbstverständlich weit in den Schatten stellt: Niemand, wirklich niemand beherrscht den Sound dieser Zeit besser als Steven John Hamper, der als »Wild« Billy Childish (das »Wild« fehlt seit geraumer Zeit) mit diversen Bands wie den Pop Rivets, Mighty Caesars, Milkshakes, Headcoats oder – in jüngerer Zeit – Buff Medways, MBEs, Spartan Dreggs oder CTMF immer noch ein Garant für absolut stimmigen, schmissigen LoFi-Rock ist. Ergänzend sei deshalb auf die fabelhafte Werkschau »Punk Rock Ist Nicht Tot! The Billy Childish Story 1977-2018« aus dem Jahr 2019 hingewiesen, die es als DoCD oder Triple-LP (Damaged Goods, DAMGOOD499LP) gibt.
Über »The New And Improved Bob Dylan« gestolpert bin ich übrigens in der Berliner Galerie Neugerriemschneider, nach der Lektüre eines Artikels von Berthold Seliger im Neuen Deutschland, in dem er die dortige Billy Childish-Ausstellung besprach. Denn Childish ist seit je nicht nur als Musiker, sondern auch als bildender Künstler und Lyriker aktiv. Es lohnt also die Beschäftigung mit ihm in mehrfacher Hinsicht – seine großformatigen Bilder malt er in einem Stil, der von van Gogh oder Munch inspiriert ist, die zeitlosen Motive stellen überwiegend Arbeitsszenen dar (das Drehen von Stricken etwa, das Schaufeln, …), dazu eine Serie mit Wolfsbildern – und einige Selbstportraits, nackt, mit deutlicher Betonung seines Gemächts. Absolut sehenswert. Ich habe mir neben der LP und dem Katalog gleich noch drei aktuelle Gedichtbände mitgenommen, die Childish als preiswerte A5-Hefte vertreibt. Zugegeben, bei Childish handelt es sich somit nicht um den klassischen Protestsänger, eher um ein Universalgenie, aber er trägt das Herz am rechten Fleck, bei allem, was er tut, nämlich links.
A propos Berthold Seliger – als Konzertveranstalter (er vertritt u.a. Patti Smith) hat er einen profunden Einblick in die kapitalistischen bzw. neoliberalen Machenschaften der Musikbranche, den er nicht nur in Buchform (»Das Geschäft mit der Musik«, »Klassikkampf« oder »Vom Imperiengeschäft«) oder Vorträgen (wie erst vor einem guten Jahr in Würzburg gehört) darlegt, sondern auch in regelmäßigen Artikeln – so erschien erst vor kurzem ein sehr lesenswerter Text »Über Bob Dylan, das Finanzkapital und die Urheberrechte«, ebenfalls im Neuen Deutschland. Womit auch der Bob Dylan-Bezug wieder hergestellt wäre …
… der mich gleich zur nächsten Protestscheibe führt (wieder ein Tipp von Seliger): Bob Vylan (!) heißt das Duo, Bobbie und Bobby Vylan die Mitglieder, »We Live Here« nach einigen über drei Jahre verstreuten EPs ihr erstes Album (Venn Records, VENN045). Zu zweit entfalten sie ein Panorama zwischen sinistrem Downbeat und dem beinahe klassischen Hardcore des Titelsongs, wobei alle Tracks von der stimmlichen Performance Bobby Vylans a.k.a. Pascal Robinson-Foster getragen werden.
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-16270544-1606752067-7782.jpeg.jpg)
Thematisiert werden – in acht Miniaturen, die nur einmal die Drei-Minuten-Marke knapp reissen – prekäres Leben und rassistische Gewalterfahrungen, die im Jahr 2020 in Folge des gewaltsamen Todes von George Floyd in den USA für Proteste und Solidaritätsadressen, vor allem aber eine breite Rassismus- und Kolonialismus-Debatte befeuerten, in deren Folge sich nicht nur die Chicks vom Dixie lossagten, sondern auch in Europa manch koloniales Erbe vom Sockel geholt wurde, wie etwa die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston in Bristol. Auch der Coburger Mohr wurde in die Debatte hierzulande einbezogen – das Argument, sein historischer Kontext sei ein anderer, seine Darstellung bei aller grafischen Reduktion eine Respektsbezeugung, zieht allerdings nur so lange, bis allen klar geworden ist, dass es eben nicht um historische oder traditionelle Befindlichkeiten geht, sondern um das Hier und Jetzt: »We live here!«, dieser in treibenden Gitarren-Hardcore gekleidete Schrei Robinson-Fosters stellt das klar. Elektropunk? Afropunk? Auf alle Fälle ein massives verbales politisches Statement – mit den richtigen Querverweisen, wenn Robinson-Foster im Video sein nagelneues CRASS-T-Shirt prominent zeigt …
Free school dinners for the poor
Pizza with a side of misery
Teachers said when I leave
No one here will miss me
Didn’t know I was a sinner
But if they say so, well I must be
Big lips, wide nose
God knows no one will trust me
Mum don’t look like me
But thank God she still loved me
Neighbours called me nigga
Told me „go back to my own country“
Said, since we arrived
This place has got so ugly
But this is my fucking country
And it’s never been fucking lovelyWe didn’t appear out of thin air
Bob Vylan: We live here!
We live here!
Das seit Jahren prominenteste Duo, wenn es um die Verknüpfung von Elektropunk mit klaren politischen Texten geht, sind sicherlich die Sleaford Mods. Namentlich beziehen sie sich natürlich auf die ur-englische Mod(ernism)-Kultur, die sich seit den 1960ern in Opposition zum Establishment sieht und deren prominentester Vertreter tatsächlich Paul Weller (s.o.) sein dürfte, auch wenn er seit Beginn seiner Solo-Karriere zumindest mich musikalisch kaum noch zu erreichen vermag als Singer/Songwriter – ich trauere Songs mit Zeilen wie »from family trees the dukes do swing« aufrichtig hinterher, gebe aber zu, dass sie ihre Stärke so wohl nur in den 1980er Jahren entfalten konnten.
Bei Jason Williamson als Sänger und Andrew Fearn am PC lohnt unbedingt der Blick in die diversen Live-Mitschnitte, die im Internet kursieren: Während sich Williamson am Mikrofon abarbeitet, begnügt sich Fearn mit dem Starten und Stoppen der Tracks am Laptop, ansonsten steht er relativ ungerührt dabei, die Bierdose in der einen, die Kippe in der anderen Hand. Es gibt kaum eine radikalere Absage an instrumentale Virtuosität bzw. überhaupt irgend eine Art von Performanz, als dieses Bild eines »Live«-Auftritts: Auf Tastendruck rattern die minimalen Loops und knatternden Beats los, zu denen Williamson seine Tiraden in bester The Streets- bzw. Mark E. Smith-Manier loslässt (allerdings ohne die konservative Schlagseite, die der Fall-Mastermind zuweilen ungeniert an den Tag gelegt hat). Williamson gibt in seinen Texten den Verlierern der Gesellschaft eine Stimme – den Jobsuchenden bzw. Arbeitslosen, den Versoffenen, Zugedröhnten, Zurückgelassenen –, und das mit einem Vokabular, das man in dieser Direktheit schon lange nicht mehr gehört hat. Äußerst spannend deshalb auch die Doku »Bunch of Kunst« von Christine Franz aus dem Jahr 2017 (noch bis Februar 2021 in der BR-Mediathek zu sehen), die die Sleaford Mods ein paar Jahre begleitet und den Aufstieg der Band vom Geheimtipp im kleinen Klub nebenan bis zum Auftritt beim Glastonbury-Festival 2016 und dem Plattenvertrag mit Rough Trade nachgezeichnet hat.
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-15626363-1594798709-2445.jpeg.jpg)
Der Output ist mittlerweile recht opulent geworden, in den Live-Sets finden sich dagegen die permanenten Highlights, die es nun auch auf einer Do-LP gibt: »All That Glue« (Rough Trade, RT0128LP) ist eine Werkschau über die letzten acht Jahre Sleaford Mods, mit allen Hits – also den Stücken, in denen die Mischung aus musikalischen Minimalismus und textlicher Grandezza optimal verschmelzen (einen ähnlich gelungenen Querschnitt bot bereits das 2016er Live-Album »Live At SO36« (Harbinger Sound, HARBINGER-USA-001).
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-9160791-1475852079-7324.jpeg.jpg)
Dass die Sleaford Mods auch nach Jahren noch überraschen können, liegt zum Einen an der Energie, die ihre Musik ungebrochen ausstrahlt, zum Anderen an der Single-Auskoppelung (»Mork n Mindy«) des im Januar 2021 erscheinenden Albums »Spare Ribs«, auf der zum ersten Mal eine Gastsängerin zu hören ist …
Mr. Williamson your employment history looks quite impressive
Sleaford Mods: Jobseeker
I’m looking at three managerial positions you previously held with quite
Reputable companies, isn’t this something you’d like to go back to?
Nah, I’d just end up fucking robbing the place
You’ve got a till full of 20s staring at you all day
I’m hardly going to bank it
I’ve got drugs to take
And a mind to break
… und diese Gastsängerin verantwortet – für mich persönlich – das Album des Jahres 2020: Billy Nomates, bürgerlich Tor Maries, lieferte 2020 als self-titled Debüt (Invada, INV240LP) ebenfalls ein Elektropunk-Album ab, das wie ein trojanisches Pferd musikalisch scheinbar glatt daherkommt, aber mit jedem Hören wächst und vor allem durch die intelligenten, doppeldeutigen Texte überzeugt.
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-15724998-1596634687-9105.jpeg.jpg)
Auch hier reissen von elf Stücken nur vier die Drei-Minuten-Marke, liefern aber in kurzer Zeit erfrischend rotzige Attitüden, wobei Maries sich textlich zusätzlich am Neoliberalismus und der Klimakatastrophe abarbeitet, insbesondere dem Individuum eine Stimme gibt als stolze Selbstbehauptung (»No«) oder als Absage an die ihm auferlegten Zwänge (»Hippy Elite«) inmitten all der Weltrettung, bei der die Regierungen seltsam untätig bleiben, während der Druck aufs Individuum wächst, sich nachhaltig zu verhalten – sie gibt den »FNP«, den »forgotten normal people« die Stimme zurück, ohne sich mit deren Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien und »Querdenken« gemein zu machen.
Das Album lief hier mehrmals hintereinander, und auch wenn einige Kritiker:innen im einen oder anderen Stück Schwächen hören mochten, so kann ich das nicht nachvollziehen, im Gegenteil: All killer, no filler wäre mein Urteil, allerdings unter Pop-Kriterien. Hier liefert Billy Nomates fehlerfrei, wobei gerade die zwei musikalisch eher abweichenden Stücke des Albums besonders gelungen sind: »Fat White Man« kommt so breitbeinig daher, dass ich nicht der erste bin, der ihr ein astreines (also kein reaktionäres) Country-Album zutrauen würde; und das unmittelbar folgende »Wild Arena« bietet den überzeugendsten Bums- resp. Club-Beat, den ich seit langem aus meinen Boxen wummern hörte. Die Entdeckung des Jahres … dank Sleaford Mods übrigens, denn erst nach einem Konzertbesuch des Duos fing Tor Maries wieder an, Musik zu machen. Und ihren Künstlernamen hat sie sich wohl ebenfalls bei diesem Anlass eingefangen, als sie alleine vor der Bühne stand und von einem angetrunkenen Konzertbesucher als »Billy Nomates« (engl. für Einzelgänger) bezeichnet wurde.
Well I havenʼt thrown myself in the road yet
Or chained myself to a jumbo jet
Avoidin plastics not very dramatic is it
But one time I cycled all the way home
Cos this planet is our only one
But nobody saw it and I
I felt all the worse for it –
It wasnʼt my bikeAll the things they do I donʼt disagree
Billy Nomates: Hippy Elite
Hug a tree for me, hug a tree for me
If I could only quit my job I’d join the hippy elite
PS: Als Lesetipp zu Kolonialismus und Post-Kolonialismus dringend empfohlen sei die Autobiografie von Stuart Hall (1932–2014, einer der Begründer der britischen »Cultural Studies«): In »Vertrauter Fremder – Ein Leben zwischen zwei Inseln« (Argument Verlag 2020) erzählt er von seiner Kindheit und Jugend in Jamaika und seinem Umzug als junger Mann nach England. Das Buch beleuchtet überwiegend die inhärenten Klassenunterschiede innerhalb der jamaikanischen Gesellschaft, aber gerade in der sehr persönlichen Erzählweise gelingt es Stuart Hall, das Augenmerk vor allem auf die Strukturen zu legen und das Allgemeine im scheinbar Individuellen herauszuarbeiten. Sehr kurzweilige, erhellende Lektüre!